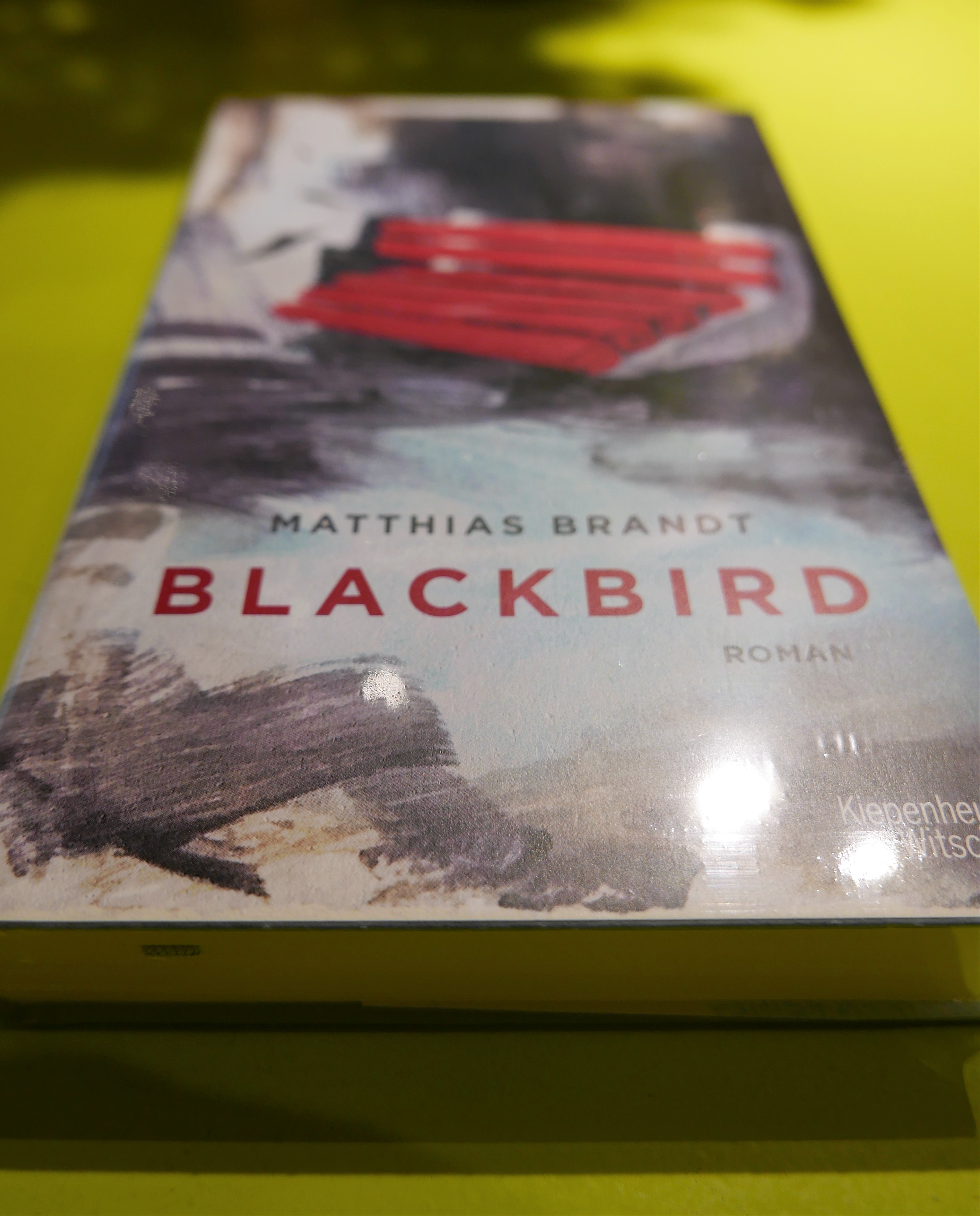„Raumpatrouille“, den Erstling und Riesenerfolg von Matthias Brandt habe ich versäumt, dafür habe ich dann gleich nach Erscheinen „Blackbird“ gelesen.
Das Buch hat mich mitgenommen. Auf verschiedenen Ebenen. Erstens ist es spannend und witzig und die Figur des Morten, genannt Motte, hätte so existieren können in den Siebzigern. Vielleicht auch in den davor oder danach kommenden Jahrzehnten mit den Themen, die ihn beschäftigen. Die sind unspektakulär, weil sie irgendwie in jeder Pubertät Thema sind. Entscheidend ist der Umgang mit Liebeskummer, Selbstfindung, Elternbeziehung und mit der schweren Krankheit seines Freundes Bogi. In den Siebzigern gab es viele Leerräume, in denen erstmal nichts passierte, Eltern waren da, aber eigentlich keine Gesprächspartner (außer vielleicht in Notfällen). Es gab sehr viel unbeobachtete Zeit, in der „man“ sich selbst überlassen blieb. Und die fiesen Lehrer, gerne noch nationalsozialistisch geprägt, konnten damals noch viel ungebändigter ihr Unwesen betreiben und niemand schützte einen vor denen. Allein die Figur des Herrn Kragler, Sport- und Geschichtslehrer, lohnt schon die Lektüre dieses Romans. Die Siebziger sind nicht plakativ im Vordergrund, sondern sie bestimmen das Leben von Motte als Hintergrundrauschen.
Im Laufe der Geschichte wirkt es, als ob Brandt sich frei schreibt, das Buch wird immer besser und dichter. Gegen Ende, es ist schon von Beginn an klar, dass Bogi schlechte Karten im Kampf gegen den Krebs hat, wirkt es, als ob Brandt sich an die, ja immerhin von ihm selbst geschaffene, Figur Motte im Schreiben heranrobbt, um das Innenleben, das Leid, das Morten erlebt, herauszuholen. Das gelingt ihm so gut, dass eine Distanzierung durch die Lesende wiederum nur schlecht gelingt. Also ganz ehrlich: ich musste wirklich weinen, so wie ich anfangs manchmal schallend lachen musste.
Absolute Leseempfehlung, nicht nur für Menschen, die die Siebziger miterlebt haben.
Verlag Kiepenheuer und Witsch, 22 Euro