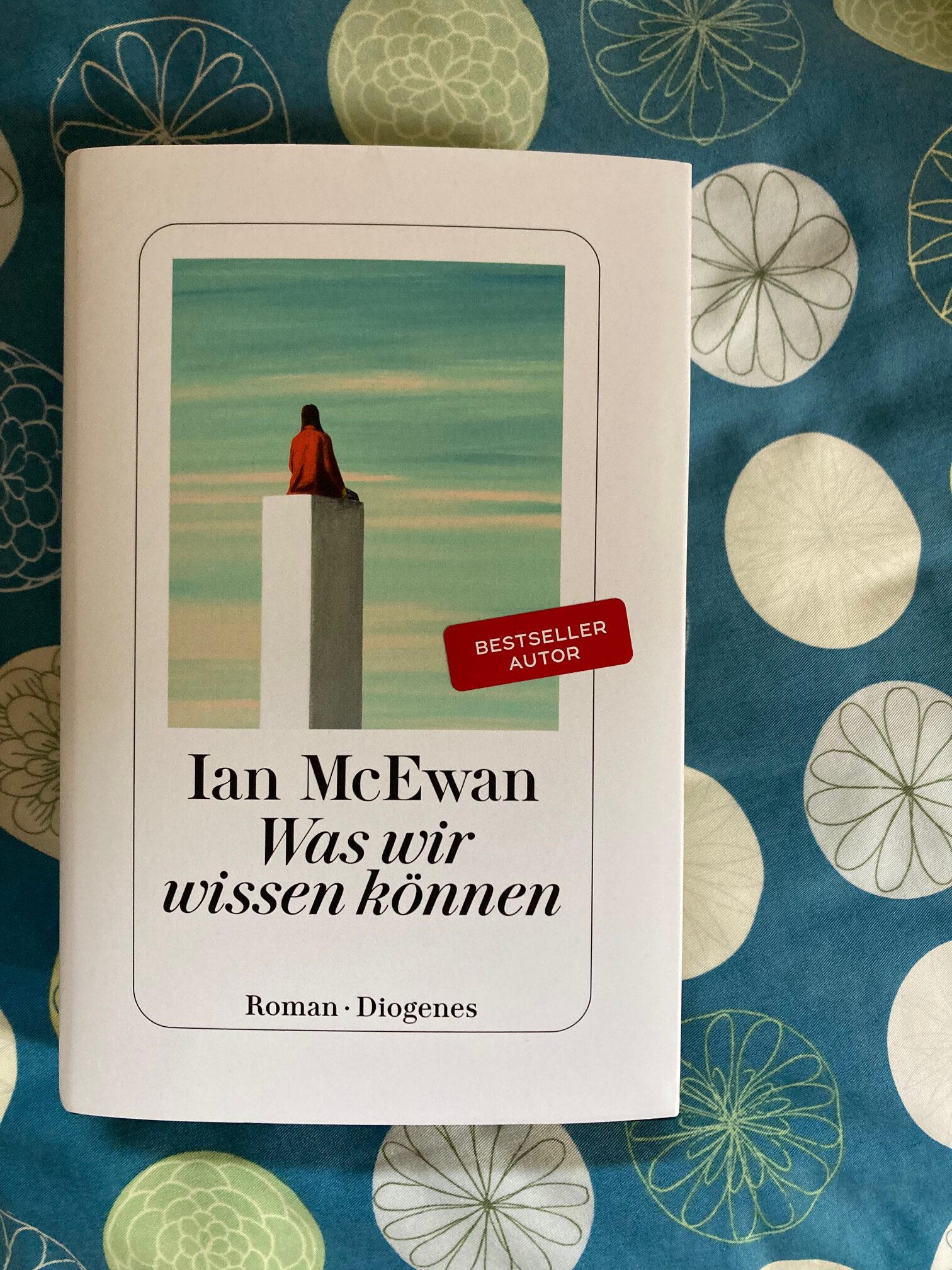Wir befinden uns zunächst im 22. Jahrhundert, im Jahr 2119 und folgen einem Wissenschaftler, der auf der Suche nach einem verloren gegangenen Sonettkranz des berühmten Dichters Francis Blundy den Rest Großbritanniens, digitale Spuren (alleine 200.000 SMS) und Bibliotheken durchsucht.
Ja, den Rest Großbritanniens: denn nach einer Disruption und einer Flut, nach Pandemien und regionalen Atomkriegen ist das Empire eine zerklüftete Insellandschaft ohne Individualverkehr, bedroht von kleinen gewaltbereiten Gruppen, die jedes Reisen mit den nur unzuverlässig verkehrenden Fähren zu einem großen Abenteuer werden lassen.
Tom, ein Literaturwissenschaftler mit Schwerpunkt Literatur der Jahre 1990 bis 2030, sitzt in seiner hoch gelegenen Bibliothek, forscht und lehrt dabei auch die neue Generation, die aber offenkundig nur wenig Sinn darin sieht, sich mit Dichtern des 20 Jahrhunderts zu beschäftigen, die immerhin der Generation angehörten, die für den jetztigen Zustand der Welt erantwortlich sind. An vielen Stellen im Roman wird darauf ein Schlaglicht geworfen, dass wir heute in der Lage wären, das Schlimmste zu verhüten, es aber einfach nicht tun. Schmerzhaft, diese richtigen Analysen.
„Etwa zu der Zeit, als das darniederliegende Deutschland von Großrussland einverleibt wurde, war die Erdbevölkerung in Folge von Tsunamis, Kriegen, Hungersnöten und Krankheiten auf knapp vier Milliarden gesunken. Und inmitten all dieses Unheils schuf die Weltliteratur ihre schönsten Klagegesänge, hinreißend nostalgisch, voll beredter Wut – Meisterwerke, so unser Versprechen, die wir gemeinsam studieren würden.“
Toms Suche nach dem Text ufert in Besessenheit aus und dieser Romanteil endet mit einem Wechsel ins Jahr 2014, in dem Francis Blundy den „Sonettkranz für Vivien“ nur einmal an einem legendären Abend vorgetragen hat. Danach gilt das Werk als verschollen. In diesem zweiten Teil berichtet Vivien, was sich an dem Abend wirklich zugetragen hat.
„Die Blundys und ihre Gäste lebten in einer Welt, die uns wie das Paradies vorkommt. Es gab einen größeren Reichtum an Blumen, Bäumen, Insekten, Vögeln und Säugetieren, wenn auch im Einzelnen immer weniger. Der Wein, den Blundys Gäste tranken, war von besserer Qualität als unser Wein, ihre Nahrung gewiss leckerer und abwechslungsreicher, zudem kam sie aus der ganzen Welt. Die Luft, die sie atmeten, war rein und weniger radioaktiv.“
Diese Stellen sind wirklich heftg in ihrer Wahrheit.
Vivien schreibt Tagebuch und eben diese Einträge sind es, die den Abend und die Geschichte des Sonettkranzes in ein neues Licht rücken.
Ein Roman über Literatur und ihre Wichtigkeit für ein Leben, über Lüge und Wahrhaftigkeit und darüber, was uns bevorstehen könnte. An manchen Stellen, vor allem im ersten Teil, wären Kürzungen willkommen gewesen, aber insgesamt schmälert es den Wert dieses Buches in keiner Weise, denn es bleibt ergreifend und packend.
Ian McEwan, „Was wir wissen können“, aus dem Englischen übertragen von Bernhard Robben, Diogenes Verlag, 28 Euro